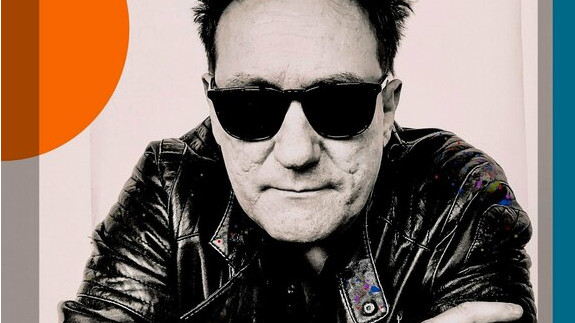Benjamin Wäntig Gustav Holsts »Savitri« und Arnold Schönbergs »Erwartung« sind meines Wissens noch nie zusammen aufgeführt worden. Die zeitlichen Umstände bringen die Komponisten nah zusammen: Sie sind beide im September 1874 geboren und arbeiteten parallel 1908 an diesen Stücken, die aber in völlig andere Welten führen. Was trennt, was verbindet sie?
Julius Zeman Der kulturgeschichtliche Hintergrund von Schönberg in Wien und Holst in London ist trotz der Gleichzeitigkeit sehr unterschiedlich. Schönberg war im Wien des frühen 20. Jahrhunderts im Zentrum der anbrechenden Moderne, konfrontiert mit den künstlerischen Revolutionen, mit dem neuen Menschenbild der Psychoanalyse – mit all diesen neuen Strömungen, die erst einige Jahre später in England ankamen. Holst war stark in der britischen Musiktradition verwurzelt, entdeckte um die Jahrhundertwende die Mythologie Indiens, damals noch Kronkolonie des weltumspannenden British Empire. Er hat sich viel von Reisen in die Ferne inspirieren lassen und sogar Sanskrit gelernt. Sein Ansatz, aber auch das Klima Londons insgesamt war kosmopolitischer.
BW Was folgt daraus für ihre Musik?
JZ Schönberg verabschiedete sich in diesen Jahren von der über Jahrhunderte vorherrschenden Tonalität. Bis zur Entwicklung seiner berühmten Zwölftontechnik sollten allerdings noch einige Jahre vergehen. In Bezug auf »Erwartung« sprach er von »freier Atonalität«. Das heißt, dass sich klassische harmonische Muster, wie wir sie aus der tonalen Tonsprache kennen, zum Beispiel Kadenzen, auflösen. Das geht Hand in Hand mit dem Text von Marie Pappenheim, in dem sich Gedanken in einem freien Fluss entfalten. Sie lösen einander in einem Bruchteil von ein paar Wörtern ab, bleiben oft unabgeschlossen. Es geht Schlag auf Schlag in schockartigen Kontrasten und die Musik folgt dieser zerrissenen Struktur. Marie Pappenheim, eine Ärztin, deren Bruder später zum direkten Kreis um Sigmund Freud gehörte, und Schönberg trafen durch ihren gemeinsamen Freundeskreis aufeinander. Er erzählte ihr, dass er endlich zum ersten Mal ein Bühnenwerk schreiben wolle, und bat sie um einen Text. Dem kam sie innerhalb von kürzester Zeit im Sommerurlaub nach. Sie berichtete Schönberg in einem Brief, wie sie auf einer Wiese lag und auf ganz spontane Art und Weise dichtete.
BW Die Surrealisten hätten später von »écriture automatique« gesprochen. Und Schönberg folgt dieser Dramaturgie?
JZ Ja, er komponiert sehr genau am Wort entlang. Auch wenn es einige strukturell genau kalkulierte Momente gibt, bleibt der Verlauf des Stücks überraschend. Es gibt auch keine »mathematische« Durchorganisation wie in späteren zwölftönigen Werken. Man merkt der Komposition ihre Spontanität an. Am ehesten spürt man eine übergeordnete Spannungskurve: ein verhaltener Beginn, der in den ersten drei kurzen Szenen schnell an Intensität zunimmt, eine lange zentrale Szene voller dramatischer Ausbrüche und ein kurzer Epilog, in dem sich die Musik quasi auflöst. Überhaupt ist die ganze Form des Monodrams, also ein Bühnenwerk mit nur einer Sängerin, fast ohne Vorbilder.
BW Was zeichnet Holst demgegenüber aus?
JZ »Savitri« ist überhaupt nicht spontan entstanden. Ihr geht eine jahrelange intensive Beschäftigung mit der indischen Mythologie voraus. Holst verarbeitet eine Episode aus dem Epos »Mahabharata«, erzählt sie aber in einer eigenen Deutung – wie auch in »Sita« –, indem er etwa eigene Vorstellungen von indischen philosophischen Konzepten wie der Illusionskraft Maya einfließen lässt. Entsprechend gründlich geplant ist auch die Komposition, die fast meditative Züge trägt.
Während Schönberg in dieser Zeit seinen Wandel hin zur Atonalität vollzog, entwickelte sich auch Holst weiter: weg von der großgesetzten Oper in der Wagnernachfolge wie noch bei »Sita« hin zu kürzeren, schlichteren Formen.
Obwohl die musikalischen Handschriften in beiden Stücken so unterschiedlich sind, haben wir jetzt bei den Proben Bestätigung dafür gefunden, wie gut sie sich ergänzen. Nicht nur durch den musikalischen Kontrast: Auch die inhaltliche Verbindung, die Fabian Sichert in seiner Inszenierung vornimmt, funktioniert sehr gut.
BW Was sind denn die musikalischen Herausforderungen solch unterschiedlich klingender Stücke?
JZ Bei »Savitri« wird es vor allem räumlich interessant, weil Orchester und Chor für die Zuschauer*innen unsichtbar hinter einer Wand positioniert sind. Mit den Sänger*innen kommuniziere ich nur per Monitor, was eine Herausforderung ist. Auch Holst hat sich im Übrigen für dieses Stück einen indirekten Klang vorgestellt. Das wird beim Zuhören sicher spannend, da man die Quelle und Richtung der Klänge nicht immer orten können wird. Besonders ist die Mischung der Klangfarben des Instrumentalensembles und des Damenchors. Die Chorpartie ist ganz anders als der Großteil der Literatur für einen Opernchor: Sie besteht nur aus Vokalisen, erfordert eine große Vielfalt von Dynamik und ist klanglich in den Orchestersatz integriert. Holst erweitert so die Klangfarbenpalette durch die Fülle an Schattierungen der menschlichen Stimme – mit wundervoller Wirkung.
»Erwartung« ist mit seiner komplexen, polyphonen Partitur zunächst einmal eine große Organisationsaufgabe. Eigentlich sieht Schönberg für das Stück einen riesigen Orchesterapparat vor. Wir spielen es jedoch in einer Kammerfassung für 17 Musiker*innen, wobei trotz der Reduktion nahezu alle Klangfarben aus der Originalfassung gewahrt bleiben. Es spielen nur alle als Solist*innen, sind gleichberechtigt und tragen die gleiche Verantwortung für ihre technisch und rhythmisch sehr herausfordernden Parts. Das kommt Schönbergs Vorstellungen von der Demokratisierung der Töne und des Orchesters entgegen. Dirigentisch ist das Stück wegen vieler Taktwechsel und ruckartiger Tempoänderungen anspruchsvoll, vor allem in der zweiten Hälfte. Das bedeutet, dass alle dieselbe Vorstellung vom jeweils nächsten Tempo haben müssen, weil ich diese Tempi beim Dirigieren nicht – wie sonst häufig möglich – durch Auftakte antizipieren kann. Außerdem verführt die enorme Spannung des Stücks dazu, dass viele Stellen zu intensiv und laut werden, obwohl Schönberg sehr genaue und differenzierte Dynamiken vorschreibt.
BW Du bist ja Korrepetitor und Kapellmeister am Saarländischen Staatstheater und hast schon in etlichen Vorstellungen am Pult des Saarländischen Staatsorchesters gestanden. Diese Produktion ist nun die erste, die du hier am Haus komplett in eigenen Händen hast. Wie sind deine Erfahrungen damit?
JZ Es ist ein schönes Gefühl, komplett eine eigene Interpretation gestalten zu können. Meine Erfahrungen, die ich als Dirigent an diesem Haus bisher gemacht habe, waren Nachdirigate, bei denen man sich weitgehend nach dem richtet, was die Kolleg*innen zuvor erarbeitet haben. Zwar beobachte ich viele Proben oder spiele auch am Klavier im Orchester mit, aber es kommt seltener vor, dass ich ganze Proben leite. Insofern ist das jetzt eine tolle und wichtige Erfahrung, ein Glücksgefühl, dass ich von Grund auf eine Interpretation mit dem Orchester erarbeiten kann.
Dazu kommt natürlich auch die Arbeit mit den Sänger*innen, die mich schon seit meiner Kindheit begleitet und mir immer eine große Freude ist. Gerade bei solch eher unbekannten und komplizierten Werken ist es wichtig, dass man sich von Vornherein auf ein musikalisches Konzept verständigt. Zur Freude am Musizieren in dieser Produktion trägt bei, dass alle – Soli, Chor und Orchester – die Stücke auf sehr hohem Niveau vorbereitet haben. Wenn alle wissen, wo wir musikalisch hinwollen, kann man sich besser auf die szenischen Proben konzentrieren und Hand in Hand mit der Szene immer mehr Feinheiten erarbeiten.