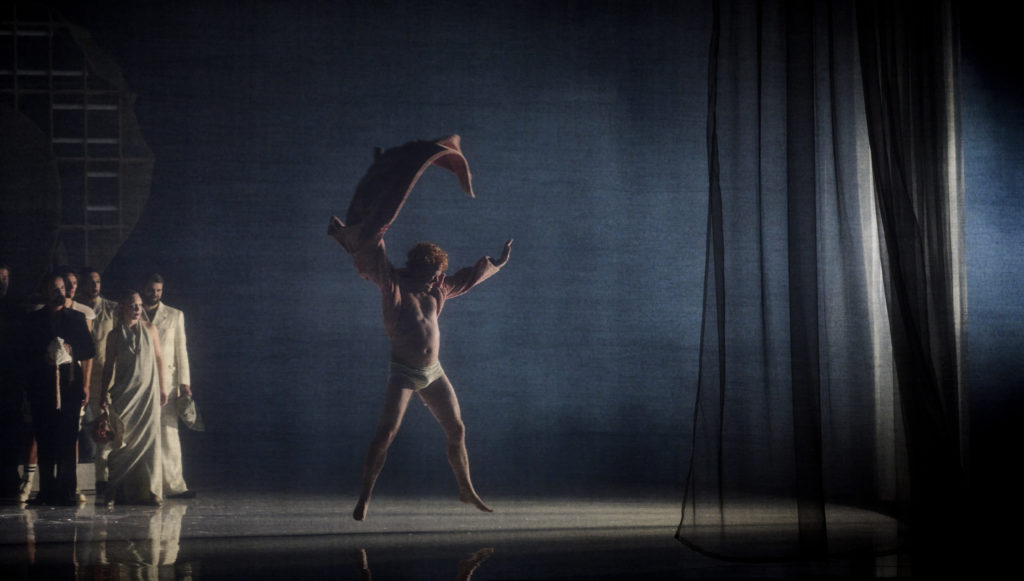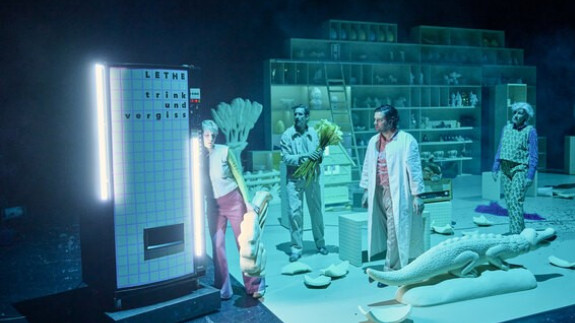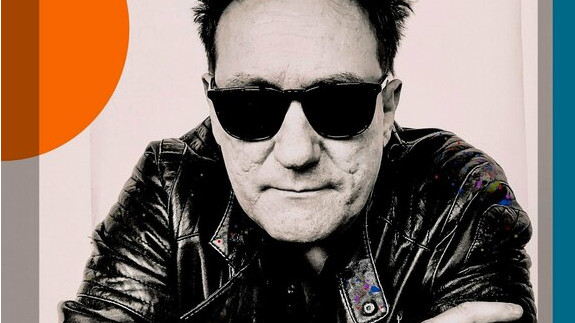1
zukunft ist verlängerung der gegenwart/vergangenheit und eben auch nicht/
beim lesen wird mir klar dass alles so kommen kann wie es da steht/
aber eben auch nicht muss!
die scheinbar dystopische beschreibung könnte viel schlimmer sein!/ aber
eben auch viel besser..
natürlich ist es eben wirklich eine frage was gut/ schlecht ist..
und mir wurde sehr klar /dass es eben sehr wohl (! ) an jedem einzelnen liegt
wie es in 20 /30 jahren sein wird/
also wie unsre kinder dann leben werden/und der rest von uns/
das bedeutet /dass das stück eben auch eine aufforderung bedeutet: seine eigene position (mit hilfe des textes
ausfindig zu machen /und wenn möglich/hinsichtlich seiner eigenen möglichkeiten/einschätzungen und absichten
danach auch folgerichtig zu handeln…
2
persönlich ist der gedanke unangenehm:
dass es »dann«(zukunft) irgendwie immer eine art »abrechnung« gibt/
Und das sowohl: von den anderen/ als auch von einem selbst!
wenn man dazu noch zeit hat/sie sich nimmt /
also wie weit ist man selber gegangen auf dem weg ?/in welche richtung?/
wo hätte er/ich/sie/es anders abbiegen sollen/können?/vielleicht müssen?
..
wobei der gedanke wohltuend ist/dass die jeweiligen determinationen/
die die personen grundiert/führt und beschränkt/ schon ziemlich umfangreich ist/
(also wie sich frau/mann/weisser /schwarzer/alter/junger/kranker/starker reicher/armer /diverser zu
verhalten haben:
angesichts der jeweiligen sozialen/moralischen/kulturellen/ökonomischen /politischen vorstellungen
einer gesellschaft)
will sagen: mein »gestaltungsfreiraum« ist eben gerade nicht so »enorm« wie es
werbung/erziehung/medien/der staat/ und alle anderen einem
suggerieren/das heisst einerseits mein »eigenanteil an weltveränderungspotential« ist definitiv
gering/
aber!/das abschieben der verantwortung auf die »herrschenden« ist eben auch eine lüge/weil sie es
ja nicht sind :»die herrschenden«/
sondern nur die menschen /»die uns und viele güter besitzen«/
(als auch die ästhetische deutungshoheit:»der herrschende geschmack ist der geschmack der
herrschenden«b.b.)
aber alles (!) ist immer in bewegung (also auch die herrschaftsverhältnisse!)/also sollten wir uns
doch einmischen!
3
die 3- teilung des textes hat mehrere gründe /einmal geht es in der tat darum ästhetisch so etwas
wie ein tryptichon herzustellen /
als eine art »altar mit 3 seiten« (der nacheinander aufgeklappt werden kann)/(vielleicht im kontext
zu
marys ästhetischen vorstellungen)/
..wo die einzelnen flügel sich gegenseitig beleuchten/und so eine mehrdimensionalität »erscheinen«
könnte/
andererseits geht es darum verschiedene möglichkeiten/tangenten vom heute in die zukunft zu
ziehen/und zu verlängern/
Und diese sich hypothetisch zu vergegenwärtigen..
und schlussendlich finde ich das »spiel mit der zeit« reizvoll/will sagen/in beide zeitachsen (vor-
zürück) ist
eine darstellung möglich!!/wobei die rückwärts laufende mir zwar schwieriger /aber nach wie vor
reizvoller
erscheint/
4
die 3 bücher/
bilden imaginiert 3 verschiedene aufeinanderfolgende zeiten ab:
(vor allem aber ja 3 verschiedene orte:) 4.1.
buch 3( kurz nach dem 3. weltkrieg )zeigt eher ein gemälde wie ich es mir nach dem 30-jährigen krieg
in
europa vorstelle:
alles liegt noch in schutt asche/hunger krankheiten gewalt überziehen das land
und wir sehen 2 menschen (wanna und foe) wie sie einen ähnlichen weg richtung »gelobtes land«
erleben/erstreben/unterschieden (aus weiblicher und männlicher sicht/) am ende ein temporäres
glück(wie jedes glück)
von jungen menschen /die noch einen langen weg vor sich haben/
4.2.
spielt einige zeit/(jahre später )in einer megametropole/die schon absolut überwacht und technokratisch organisiert ist/
(ich war nur einmal in china in einer 34 millionen-stadt aber so »dinge« habe ich da gefühlt)
hier agieren die ki- figuren als anwälte des staates /als ordnungsapparate /aber auch als produzenten /therapeuten und management-
ausführende in unterschiedlichen rollen/
foe und mary sind 2 »humanoide«(hier im sinne von »teilmenschlich« verstanden) aussenseiter /beide verletzt/
er/psychisch -sie physisch/
sie bilden ein ungleiches paar und mary versucht eigentlich durch und über: kunstproduktion und kunsterörterung /
so etwas wie ein produktives auf kommunikation /spiel und/oder manufaktur beruhendes leben zu schaffen /
in einer welt in der es scheinbar keinen »widerstand« sondern nur noch entropie/also: den versuch zur absoluten ordnung
Gibt/
(in diesem teil wird deutlich /dass nicht die ki-robots »böse« sind /sondern die memschen /die sie programmieren(lassen)
aber auch /dass in dieser(!) ki-welt so etwas wie »widerstand« ähnlich wie bei »1984« oder in »brazil«
kaum noch eine chance hat…
4.3.
hier noch einige zeit später sehen wir die »absolut andere seite/«
Wir sind in :
einer völlig zerstörten müll- und todeswelt/ auf der die ausgestossenen /kaputten aber eben noch »überlebt habenden/«
versuchen zu existieren/ und neue oder scheinbar alte (?)formen des zusammenlebens ausprobieren /reorganisieren/
Diese welt ist erstaunlicherweise grösstenteils (wie heute in somalia/jemen /haiti z.b) längst realität/
(nur eben nicht unsere)
..
spannend wird die experimentieranordnung für »privilegierte zuschauende« dadurch/dass eine »ausgestossene person der oberen mittelschicht«
(anthony) versucht:
in die welt der freaks/halb-menschen und outlaws einzudringen /diese begehren nach einem »anderen« leben bezahlt
Der aus dem chor der bürger ausgestossene(anthony) relativ schnell mit dem tod /
weil er die herrschenden »archaischen« regeln nicht akzeptiert/versteht/wahrhaben will/
..
celine/rimbaud/jack london(wolfsblut)/tolstoi(der lebende leichnam)/marianne herzog(nicht den hunger verlieren) haben
solche »reisen« in andere milleus /kontinente und lebensentwürfe schon vorher beschrieben und teilweise(rimbaud) dafür mit ihrem eigenen leben bezahlt..
seltsamerweise erscheint in diesem teil der hauptaspekt des sonstigen textes:»die einsamkeit«
eine eher untergeordnete rolle zu spielen!
/vielleicht weil die unglaubliche anstrengung des überlebens dazu keine zeit lässt oder
Diese systeme (trotz ihrer härte) eine relative stabilität erzeugen/darstellen..
5
die ki figuren sind möglichst symphatisch oder zumindestens komisch gestaltet/
Und darzustellen!!!
(wie gesagt: sie selber können nicht »böse« (sein allerhöchstens die programmierer/)
gerade in ihrer unfertigkeit/naivität liegt ihr charme ihre komik!/
und manchmal eben auch (wie bei wanna-ki) ihr widerstandspotential..
6
die genre der 3 bücher untescheiden sich und soll(t)en auch möglichst unterschiedlich dargestellt werden/
so dass das triptychon wirklich plastisch wird!
..
buch 2 ist eine melancholische komödie mit starken essayistische zügen/
buch 3 ein roadmovie und natürlich eine liebesgeschichte aber auch ein »coming out of age drama«/
buch 1 der eigentlich science fiction: anfangend mit einer art »teacher-stand up comedy« so ist zumindstens der plan!!!