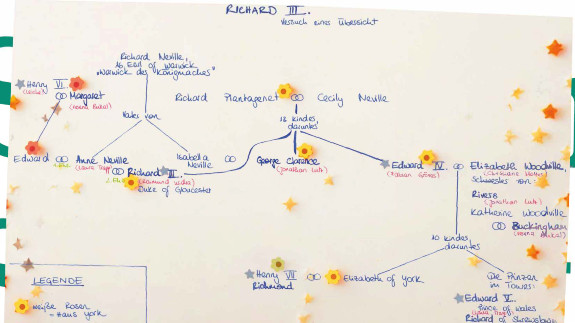Lara Scherpinski: „Blutschwester“ erzählt von einer Frau, die an Krebs erkrankt ist und auf der Intensivstation liegt. Für das Bühnenbild habe ich nach einer Übersetzung gesucht, einem anderen Transitraum. Die Intensivstation kann für Menschen ein Raum zwischen Leben und Sterben sein oder zwischen Krankheit und Gesundheit, sie ist aber auch ein Warteraum für die Angehörigen. Für die Bühne habe ich Räume des Übergangs collagiert: Bahnhofshallen, Flughäfen, ein Haus ohne Wände und Decken.
Dr. Ingrid von Beyme: Wenn Sie sagen, dass Sie einen Transitraum entwerfen, denke ich an Else Blankenhorns Darstellungen von Transzendenz. Sie hat zum Beispiel ein Haus mit durchsichtigen Wänden gemalt, in das man hineinblicken kann. In den einzelnen Zimmern wollte sie Liebespaare einquartieren, deren Ausgrabung und Auferstehung sie durch ihre Gestaltung von Geldscheinen finanzieren wollte. Und Blankenhorn stellte in ihren Bildern oft Lotusblüten dar, die im Buddhismus das Symbol für Chakren sind. Das Kronenchakra, das höchste Chakra über dem Scheitelpunkt des Kopfes, ist die Verbindung zwischen dem Menschen und einer höheren göttlich-kosmischen Einheit. Blankenhorn platzierte sehr oft Blüten über den Köpfen ihrer Figuren. Für mich waren diese schwebenden Blüten immer auch ein Zeichen für spirituelle Energie und Transzendenz.
Lara Scherpinski: Wie die Flammen über den Köpfen der Apostel.
Dr. Ingrid von Beyme: Ja, aber in Blütenform. Das ist auffällig: Dass man auch gerade in Anbetracht des Todes die Hoffnung hat, dass es weitergeht, in höheren Räumen. Auf dem Gemälde, auf das Sie sich im Bühnenbild beziehen, gibt es ja auch etwas Sphärisches, eine Art kosmischen Wirbel. Darin liegt auch etwas Bedrohliches, etwas Beängstigendes vielleicht, aber es hat zudem etwas Öffnendes, man weiß noch nicht, was auf einen zukommt. Durch den roten Mond, die weiße Sonne, die Sternenkonfigurationen, dynamische Wolkengebilde und kometenartige Streiflichter wirkt es wie ein kosmischer Sturm. Und dieses kleine Gesicht am unteren Bildrand könnte man als Selbstbildnis interpretieren – und darüber öffnet sich der gewaltige Kosmos.
Blankenhorn hat sehr viel zu den Themen Auferstehung und Himmelfahrt gearbeitet und zu verstorbenen Liebespaaren, die erlöst werden sollten. Sie hat sich ein schönes Leben vorgestellt für diese Paare, die sie ausgraben wollte, um für sie in „ewiger Häuslichkeit“ zu sorgen. Und dasselbe wird sie für sich selbst auch erhofft haben, dieses ewige Leben, weil sie sehr religiös war.
Verena Katz: Religiös, ja, aber wie ist sie in Kontakt gekommen mit dem Buddhismus, wissen Sie das?
Dr. Ingrid von Beyme: Das kann ich nicht belegen, aber es gab um die Jahrhundertwende die Zeitschrift „Lotusblüte“. Darin wurden Texte über Buddhismus, östliche Philosophie oder auch Yoga abgedruckt. Dieses Wissen war also zu dieser Zeit schon zugänglich und da das in Blankenhorns Bildwerken so oft auftaucht, denke ich schon, dass sie das gekannt haben könnte. Es schließt sich ja auch nicht aus, sondern ist nur eine zusätzliche Möglichkeit zum Christentum. Wie eine Art übergreifende Religion, wie sie das einmal in einem Gedicht so formulierte: „Weltenreligionen ziehen an mir vorüber.“ Sie hatte also nicht nur eine, sondern mehrere Religionen im Blick.
„Dunkle, schwarze Wolken auf Zügen die
Geheimnisvoll die Nacht durchpflügen
Liest man nur einmal davon so sieht
Im Geiste oft man sie entgleisen + Schreie
hört man in der Fantasie.“
(Aus dem Katalog zur Ausstellung „Else Blankenhorn – Das Gedankenleben ist doch wirklich“. Hrsg. von Ingrid von Beyme und Thomas Röske. Verlag Das Wunderhorn 2022, Seite 14)
Dr. Ingrid von Beyme: Dieses Zitat aus einem Gedicht Blankenhorns passt auch sehr gut zu ihrem bildkünstlerischen Werk. Diese schwarzen Wolken, die geheimnisvoll die Nacht durchpflügen, haben auch etwas Gewaltiges.
Lara Scherpinski: Dass hier die Züge vorkommen, das erinnert mich wiederum an die Bahnhofshallen, an die ich beim Bühnenbildentwurf dachte.
Wissen Sie, woher Blankenhorns Bezüge kommen? Sicherlich ist ihre Herkunft eine Möglichkeit gewesen, an solche Inhalte heranzukommen, aber in dem Moment, in dem sie dann in der Psychiatrie war, wissen Sie, oder ist da überliefert, wie sie da an dieses Material kam?
Dr. Ingrid von Beyme: Die Privatanstalt Bellevue war eine sehr renommierte Institution in der Schweiz. Dorthin kamen Menschen aus ganz Europa. Das Sanatorium in Kreuzlingen am Bodensee war wahnsinnig teuer. Der Monatsaufenthalt einer Patientin entsprach dem Jahresgehalt einer Arbeiterfamilie. Das konnten sich wirklich nur die sehr reichen und häufig auch sehr gebildeten Intellektuellen leisten, die dort gezielt gefördert wurden. Die Klinik hat ein abwechslungsreiches Kulturprogramm angeboten: Es wurden Konzerte organisiert und aktuelle Ausstellungen besprochen, man diskutierte über Kunst und stellte eine umfangreiche Anstaltsbibliothek zur Verfügung – die Beschäftigung mit Kunst und Kultur war Heilungsprogramm.
Ludwig Binswanger hat für Patienten, die eine kulturelle Umgebung gewohnt waren, Kultur in der Anstalt weitergeführt, um sie anzuregen und ihre Heilung zu fördern. Auch Ernst Ludwig Kirchner war dort Patient, er hat Blankenhorns Werke gesehen und sie in seinen Skizzenbüchern beschrieben. Binswanger hatte Kirchner Blankenhorns Werke gezeigt, um ihn zu motivieren, wieder selbst künstlerisch tätig zu werden. Wir wissen auch, dass es im Bellevue einen Psychiater Smidt gab, der sich für japanische Kunst interessierte und später auch darüber publizierte. Er hat sich mit Blankenhorn über japanische Kunst ausgetauscht. Das sind Einflüsse, die auch in ihrem Werk sichtbar werden.
Verena Katz: Die Werke, die Prinzhorn dann zusammengetragen hat, kamen aber nicht nur aus der Kreuzlinger Anstalt Bellevue?
Dr. Ingrid von Beyme: Als Hans Prinzhorn nach dem Ersten Weltkrieg nach Heidelberg an die Psychiatrische Universitätsklinik kam, schrieb er zusammen mit dem Klinikdirektor Karl Wilmanns alle deutschsprachigen psychiatrische Anstalten und Privatkliniken an und fragte nach Bildwerken von Patienten. Ein kleiner Bestand war schon da, den Prinzhorn dann auf rund 5000 Werke erweiterte. Prinzhorn kannte auch das Bellevue und hatte von dort Blankenhorns Krankenakte angefordert. Ursprünglich war Blankenhorn als einzige Frau in seiner „Bildnerei der Geisteskranken“ zur Veröffentlichung geplant. Er wollte zwölf sogenannte „schizophrene Meister“ vorstellen. Und dann musste er aus Platzgründen kürzen. Er entschied sich, die zwei komplexesten Künstler zu streichen, nämlich Else Blankenhorn und Heinrich Mebes, und wollte beide separat in einer Monografie publizieren, weil ihr Werk so besonders war. Dazu ist es nicht mehr gekommen, Prinzhorn ist 1933 gestorben. Blankenhorn blieb deshalb unpubliziert, obwohl sie bis heute die meistgezeigte Künstlerin unserer Sammlung ist und ihr Œuvre mit über 300 Werken auch das umfangreichste der historischen Sammlung ist.
Lara Scherpinski: Und durch die Sammlung Prinzhorn ist sie dann nicht in Vergessenheit geraten? Oder gab es später einen Moment, in dem die Erinnerung an sie wieder hochgeholt werden musste?
Dr. Ingrid von Beyme: Die Sammlung war von den Nationalsozialisten missbraucht worden. Für die Feme-Ausstellung „Entartete Kunst“ wurden Werke aus der Sammlung Prinzhorn angefordert, übrigens auch sieben Bilder von Else Blankenhorn. In dieser Wanderausstellung hatte man durch Gegenüberstellungen einen Vergleich gemacht zwischen „Irrenkunst“ und Werken von professionellen Künstlern. Und der perfide Ansatz war: Wenn das ein „Irrer“ malte und dies ein professioneller Künstler und Sie finden das Werk von dem „Irren“ sogar besser, dann kann man zurecht sagen, das ist „entartete“ Kunst, die wir nicht mit unseren Steuergeldern bezahlen sollten. Dieser Vergleich diente dazu, die moderne Kunst zu diffamieren.
Die Ausstellung „Entartete Kunst“ war eine Wanderausstellung, die zum ersten Mal 1937 in München gezeigt wurde. In der Berliner Station 1938 gab es dann auch einen Ausstellungsführer und darin sind Werke aus der Sammlung Prinzhorn abgebildet – in Gegenüberstellung mit Werken professioneller Künstler. Wir wissen nicht genau, welche Werke ausgestellt wurden, aber wir haben eine Liste von rund 100 Werken, die angefordert wurden für diese Ausstellung. Nicht alle Werke wurden zurückgeschickt, manche wurden auch vernichtet. Aber die Werke von Blankenhorn sind nach Heidelberg zurückgekommen.
Es ist ein Wunder, dass die Sammlung Prinzhorn überhaupt die Nazi-Zeit überstanden hat. Da sie für die Nazis ein wichtiges Vergleichsmaterial zur Diffamierung von Kunst der Moderne war, hat sie vielleicht aus dem Grund überlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet sie erstmal in Vergessenheit. 1963 hat Harald Szeemann dann zum ersten Mal 250 Werke aus der Sammlung Prinzhorn in Bern ausgestellt und 1980/1981 gab es eine große Wanderausstellung. Vor 25 Jahren wurde unser Museum gegründet, und unser Bestand ist inzwischen auf rund 40.000 Werke angewachsen: Das sind vor allem Zeichnungen, aber auch Gemälde, Skulpturen, textile Arbeiten und viele Briefe. Seitdem wird unsere Sammlung immer bekannter mit steigenden, auch internationalen Besucherzahlen. Und Blankenhorn ist durch eine Retrospektive in Müllheim, Heidelberg und im Museum Gugging in der Nähe von Wien, dem bekanntesten Museum für Art Brut in Österreich, noch präsenter geworden.
Verena Katz: Können Sie zu Blankenhorns Krebserkrankung auch etwas sagen, ist das eher ein biografischer Fakt oder gibt es auch eine Verbindung mit ihrer Kunst?
Dr. Ingrid von Beyme: Die Krebserkrankung taucht relativ spät auf in ihrer Krankenakte. Blankenhorn hat ja schon 1908 angefangen mit ihrer Geldscheinproduktion und bis kurz vor ihrem Tod 1919 künstlerisch gearbeitet, da hatte sie nochmal einen richtig kreativen Schub.
Nach dem Ersten Weltkrieges wurde sie verlegt vom Bellevue in die deutsche Anstalt Reichenau bei Konstanz, weil die Familie das einfach nicht mehr finanzieren konnte. In der Krankenakte in Konstanz gibt es dann einen Eintrag, dass man ihr das Malmaterial wegnehmen musste, weil sie sogar Wände bemalt hat – einfach alles, was sie in die Finger bekam. Das war ein halbes Jahr vor ihrem Tod, aber ich kann keinen direkten Zusammenhang herstellen zwischen ihrer Krebserkrankung und ihren Werken.
Verena Katz: Als sie angefangen hat, die Wände anzumalen, waren das auch Geldscheine?
Dr. Ingrid von Beyme: Ich glaube nicht. Die Geldscheine waren ja durchaus in einem Format, das gehändelt werden sollte, weil Blankenhorn sie als reales Geld ansah. Und Geld an der Wand, das man nicht verschicken kann, hätte ihr nicht viel genutzt.
Sie hat auch immer wieder gefordert, dem Kaiser neues Geld zu senden. Durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg wusste sie, dass Geld immer weniger wert wurde, dass sie mehr produzieren musste, um mithalten zu können. Und ihre anfangs sehr detailliert und liebevoll gestalteten Geldscheine wurden dann gröber und nicht mehr so minutiös ausgestaltet – ich nehme an, weil sie schneller produzieren wollte, musste.

Außenansicht Sammlung Prinzhorn (c) Atelier Altenkirchen
Ausflugstipp: Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, https://www.sammlung-prinzhorn.de/
Die Sammlung Prinzhorn ist ein Museum für Kunst von Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen. Sie ist Teil des Departments für Psychosoziale Medizin, Prävention und Familiengesundheit (PPF) am Universitätsklinikum Heidelberg. Der einzigartige Bestand von rund 40.000 bildkünstlerischen Werken, Texten und Musikstücken der Zeit von 1840 bis heute, wesentlich aus deutschsprachigen Ländern, wächst ständig.
Blankenhorn ist mit zwei großformatigen Werken in der Dauerausstellung zu sehen und bis zum 19. April 2026 zusätzlich mit vier Werken in der Sonderausstellung „Wer bin ich? Bilder der Identitätssuche“
Dr. Ingrid von Beyme: Blankenhorn hat sich auch mit ihrer Identität und verschiedenen Rollen auseinandergesetzt. Sie stellte sich als Sängerin dar oder als Kaiserin, aber auch als Komponistin. Und – vielleicht kann man es vergleichen mit dem Mythos aus Ovids Metamorphosen – auch als Baumfrau. In den Metamorphosen verwandelt sich Daphne ja beispielsweise in einen Lorbeerbaum – um sich vor den Nachstellungen Apollos zu schützen.
Lara Scherpinski: Das kommt auch im Stück vor.
Dr. Ingrid von Beyme: Ja? Denn das gibt es bei Blankenhorn auch. Sie stellt sich auch als Baumfrau dar und aus den Extremitäten wachsen Blätter. Ich vermute, dass das vielleicht auch eine Art Schutzmechanismus für sie war. Denn sie war einerseits voller Sehnsucht nach einem Mann und einer Familie und andererseits sehr kontaktscheu.
Ihrem Psychiater sagte sie: „Der Kaiser hat in jeden Baum den Namen Else eingeschrieben.“ Zu einer Baumgestalt notierte sie zur Zeichnung: „der Ursprung“. Es gibt in der keltischen Mythologie ja die Vorstellung, dass die Menschen eigentlich aus Bäumen entstanden sind, und dass die Bäume ihren Charakter widerspiegeln.
Von Else Blankenhorn ist eine Fotografie erhalten, auf der sie sich unter einen großen Baum inszeniert. Dieses Motiv kommt auch in ihren Bildern vor, in denen sie sich dann auch zur Baumfrau weiterentwickelt. Und sie hatte ein ganz eigenes Symbol, das war ein Tannenbäumchen, das in vielen ihrer Werke auftaucht. Es war eine Art Schutzsymbol für sie, denn die geschlossene Abteilung, in der sie lebte, war die „Villa Tannegg“. Tannegg bedeutet Ort der Tannen. Und das bedeutete für sie Geborgenheit.