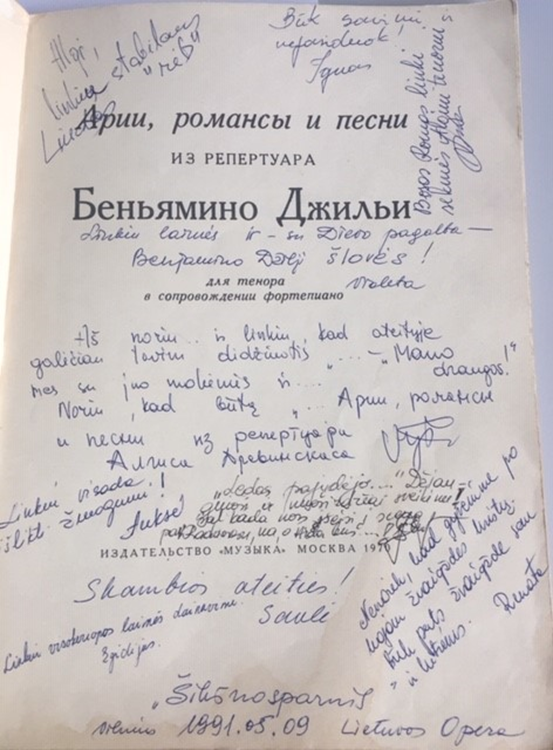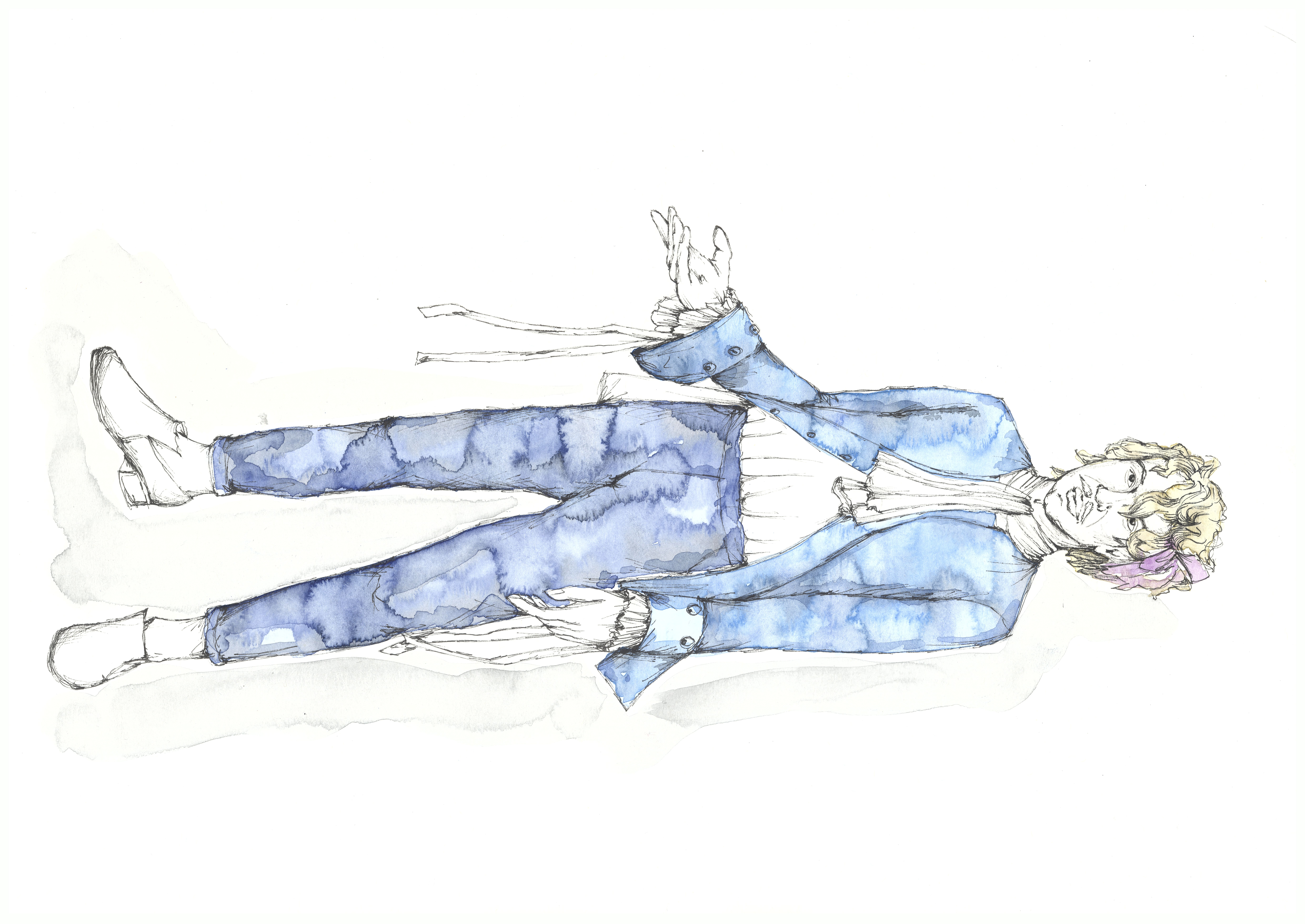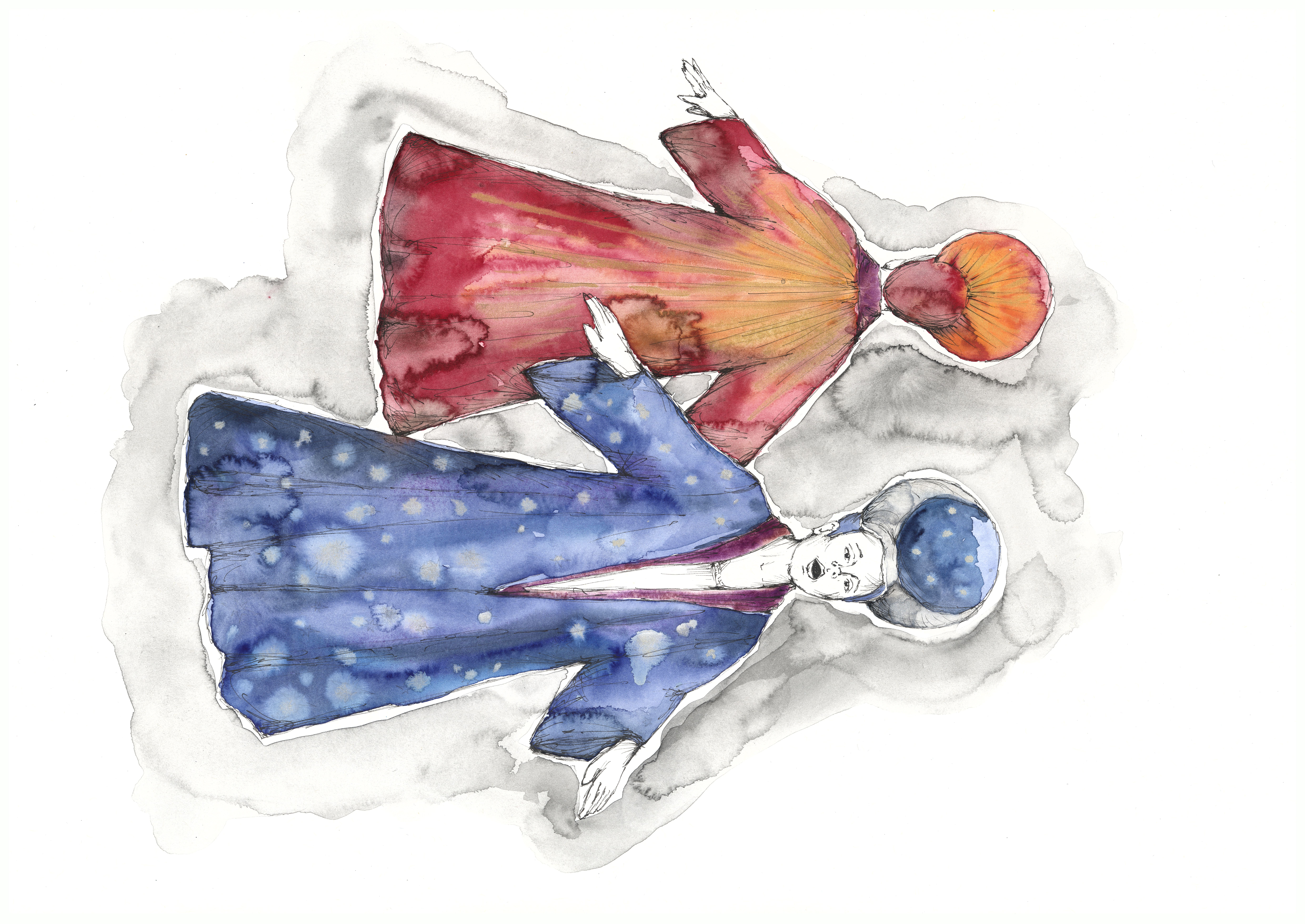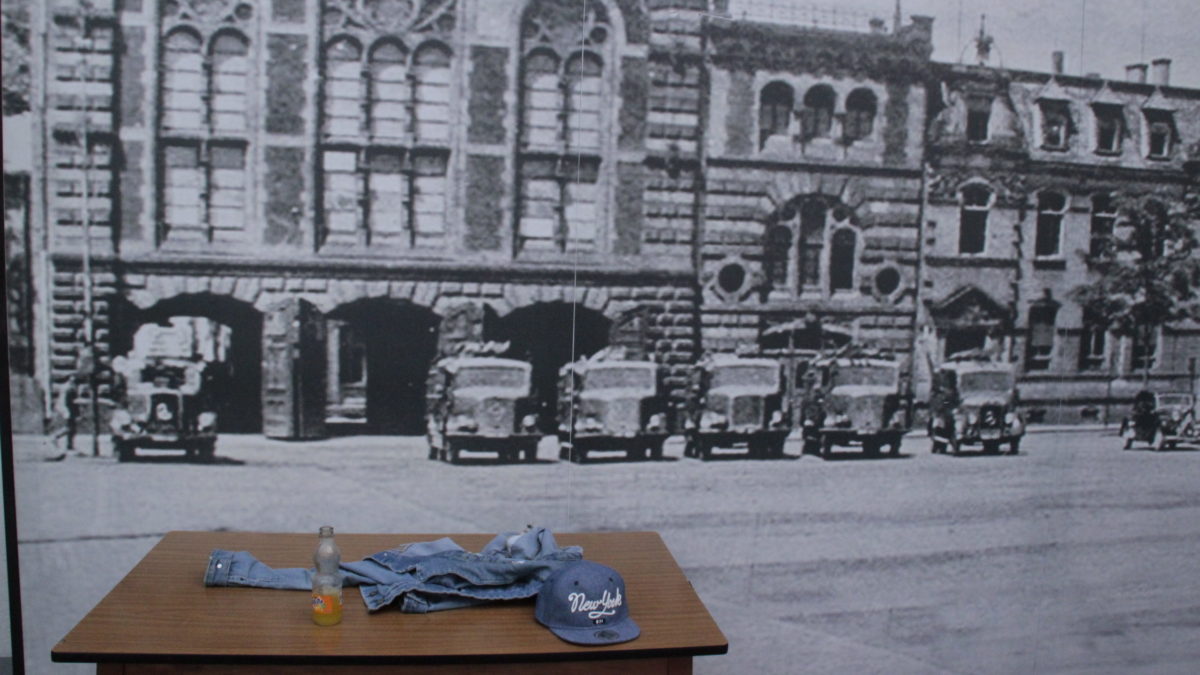Über einen Diskurs der Gegensätzlichkeit.
Strauss und Hofmannsthal. Kaum eine andere Kollaboration in der Musikgeschichte scheint so selbstverständlich wie diese. In der Geschichte der Oper des frühen 20. Jahrhunderts stellen sie eine Art Institution dar. Das schicksalhafte Aufeinandertreffen von Dichter und Komponist sollte in fünf Opern seine künstlerische Apotheose finden.

Rund 600 Briefe in 29 Jahren belegen das beständige Ringen um ein gleichberechtigtes Miteinander: Fragen um Stoffwahl und Dramaturgie wie der musikalischen Gestaltung haben Textdichter und Komponist erörtert. Nicht selten bat Hofmannsthal während der gemeinsamen Arbeit an einem Werk um genaue Vorgaben oder Strauss um zusätzliche Verse für seine Musik.
War »Elektra« (1909) noch ein Werk, dessen Text auf einem bereits vorhandenen Gedicht beruhte, entstand mit dem »Rosenkavalier« 1911 erstmals ein Libretto, welches in einem beständigen Austausch zwischen Dichter und Komponist entstand. Ein Umstand, der sich maßgeblich auf die musikalische Dramaturgie und kompositorische Diktion ihrer gemeinsamen Werke auswirkte.

F.K.: Ohne euch gleichzusetzen mit Strauss und Hofmannsthal, aber auch ihr arbeitet schon seit Jahren im Team, erarbeitet allumfassend das Konzept einer Inszenierung. Könnt ihr etwas über eure »Arbeitswege« erzählen?
A.S.: Alles entsteht aus einem Dialog. Es geht darum, mit dem Stück, mit sich selbst und schließlich miteinander in Dialog zu treten. Für uns ist die ständige Kommunikation sehr wichtig, es ist ein Gedankenaustausch, der inspiriert und beflügelt. Und vor allem ist es wichtig, gegensätzliche Meinungen voneinander zuzulassen und immer wieder neue Fragen zu stellen.
M.P.: … und dazu gehört auch Vertrauen. Für unsere Arbeitsweise ist es essentiell, dass die verschiedenen künstlerischen Bereiche ineinanderfließen, es soll eine natürliche Wechselwirkung zwischen Figurengestaltung, Raum- und Kostümkonzept entstehen. Das Ziel ist es, ein einheitliches Ganzes formen zu können.

Das Hochgefühl der gemeinsamen Arbeit von Strauss und Hofmannsthal sollte nicht lange andauern. Zwischen 1911 und 1916 wurde mit »Ariadne auf Naxos« die künstlerische Beziehung der beiden auf ihre erste Bewährungsprobe gestellt: Nach dem Misserfolg der Stuttgarter Uraufführung 1912 wollte Strauss das Werk, welches seinen Ursprung in der fixen Idee eines sparten- und genreübergreifenden Experiments fand, gründlich überarbeiten. Ein Schritt, den Hofmannsthal zumindest vorerst nicht bereit war zu gehen, da er die Arbeit als abgeschlossen betrachtete und sich bereits dem nächsten gemeinsamen Werk, der »Frau ohne Schatten«, widmete. Pikiert bis verärgert reagierte er auf die detaillierten Anweisungen seines Komponistenfreundes.

Das Ringen um Inhalt und Form, um die musikalische Struktur wie die inhaltliche Dramaturgie, mit dem Strauss und Hofmannsthal während der Arbeit an »Ariadne auf Naxos« konfrontiert waren, lässt sich als exemplarisch begreifen. Der Weg eines künstlerischen »Produkts« ist oftmals vieles, aber selten linear. Ein Umstand, der damals wie heute, in einer schnelllebigen, von Effizienz und Effektivität geprägten Gesellschaft, gleichermaßen Fluch und Segen sein kann. Ein vermeintlich oasenhafter Ort, an welchem andere Maßstäbe gelten, die Zeit anders zählt, der Geist von Kreativität geküsst wird. Und doch unterliegt sie den Gesetzen der Realität und erhebt sogar Anspruch auf diese! Als Spiegel, als Kommentar, als Abbild oder Zerrbild. Ein ständiges Austarieren zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Fakt und Fiktion, aus Spiel wird Ernst.

Kunst ist Kampf. Sie ist ein Kampf um das (vermeintlich) richtige Wort zur richtigen Zeit, den richtigen Ton im noch richtigeren Moment, sie ist ein Kampf um Stimmung, Atmosphäre, Emotion, Inhalt, Ästhetik. Sie ist der Versuch, eine noch so flüchtige Idee mit bloßen Fingern zu packen, zu konservieren und – noch viel wichtiger – zu konvertieren. In etwas, was gleichermaßen gegenwärtig wie zeitlos ist. Das Innerste soll nach Außen, das Unaussprechliche, geschrieben, gesprochen, gesungen werden. Jetzt und für immer. Vielleicht.

Strauss und Hofmannsthal waren gut darin, den Nebel der Idee mit ihren Händen zu greifen. Eine solche Idee war ursprünglich auch »Ariadne auf Naxos«. Eine untypische Oper, als Experiment gedacht, sollte eine 30-minütige Oper für ein kleines Kammerorchester mit Molières Ballettkomödie »Der Bürger als Edelmann« für den Regisseur Max Reinhardt kombiniert werden. »Die hübsche Idee – von der nüchternsten Prosakomödie bis zum reinsten Musikerlebnis – hatte sich praktisch in keiner Weise bewährt«, erkannte Strauss später, »ganz banal gesprochen: weil ein Publikum, das ins Schauspiel geht, keine Oper hören will, und umgekehrt. Man hatte für den hübschen Zwitter kein kulturelles Verständnis.«
Um das Stück zu retten, trennten Strauss und Hofmannsthal die offensichtlich unvereinbaren Elemente wieder. 1916 kam die Operneinlage als selbstständiges Werk heraus und ging triumphierend in den Werkekanon über. Vom einstigen Experiment blieben die Oper und die Bühnenmusik. Letztere arbeitete Strauss über mehrere Jahre in eine Orchestersuite um, die er aus eben jener Bühnenmusik extrahierte.

Strauss‘ Glaube an das visionäre Potenzial seines Werks war allen wirtschaftlichen wie ideellen Zweifeln erhaben. Er setzte sich durch. Und obgleich Strauss und Hofmannsthal das Experiments einer Kombination von Oper und Schauspiel (in diesem konkreten Fall) für gescheitert ansahen, setzten sie mit »Ariadne auf Naxos« neue musikdramaturgische und ästhetische Maßstäbe.
Einer verhältnismäßig kurzen spätromantischen Kammeroper mit Opera-Buffa-Elementen setzten sie ein (rezitativisches) Vorspiel voran, dessen Geschehen hinter den Theaterkulissen stattfindet.

Bei dem Theater im Theater eröffneten die Autoren nun einen zeitlosen theaterpolitischen Diskurs: Mit den originären Mitteln des Theaters entspinnt sich ein augenzwinkernder Plot über die Borniertheit der Theaterwelt. Eine Parabel auf die Kunstfreiheit im Spannungsfeld zwischen künstlerischem Idealismus und (politischem) Realismus, in der scheinbar willkürliche Zensurmechanismen durch Mäzene der Selbstwirksamkeit des Künstlers zusetzen.

F.K.: Strauss und Hofmannsthal stellen mit »Ariadne auf Naxos« die zwingende Frage nach dem Wirken der Kunst. Nach ihrer Legitimation. Fragen, die in den vergangenen Monaten immer wieder aufgekommen sind. Welchen Einfluss hatte das auf euch, auf euer künstlerisches Selbstverständnis?
A. S.: Vor eineinhalb Jahren geschah das Unvorstellbare und plötzlich stand die Frage im Raum, ob Kunst, Theater oder Oper überhaupt eine Daseinsberechtigung haben: Das ambivalente Wort »Systemrelevanz« schlich sich in die Nachrichten. Und auch wenn es einem bewusst ist, dass die Schließungen damals notwendig waren, sitzt der Schock immer noch tief. Auf einmal standen die Opernhäuser leer, wir Kunstschaffende fanden uns in gewisser Hinsicht auf Ariadnes verlassener Insel wieder… die Oper war zumindest »scheintot«. Dieses Erlebnis war ausschlaggebend für das Regiekonzept: Für uns symbolisiert Ariadne die Fragilität der Gattung Oper selbst.
M.P.: Die Krise hat uns auch gezeigt, dass nur die wenigsten über die Komplexität der Theaterarbeit, oder speziell des Musiktheaters, Bescheid wissen. Wie viele Fachkompetenzen von so unterschiedlichen Bereichen nötig sind um einen einzigen Theaterabend entstehen zu lassen. Gerade die stückimmanente, mit ziemlicher Selbstironie entworfene, szenische Situation des Vorspiels gibt uns eine einzigartige Möglichkeit all das aufzuzeigen, was sonst im Off verborgen bleibt. Der Schleier wird gelüftet, das Publikum wird hinter die Kulissen geführt und darf dem Intendanten, Dirigenten, Orchester, Sänger:innen, Inspizient:innen, Maskenbildner:innen, Bühnentechniker:innen, Ankleider:innen bei der Arbeit zusehen. Für einen Abend lang haben wir sozusagen freien Eintritt in den Backstage-Bereich.

Zwei schier unvereinbare Welten stehen sich bei Strauss und Hofmannsthal gegenüber: Kunst versus Kapitalismus. Realismus versus Pragmatismus. Unterschiedlich und doch abhängig. Die »einsame Insel« des Komponisten auf der einen Seite, die realen Zwänge des Auftraggebers auf der anderen. Ein Problem zeitloser Dringlichkeit, auch wenn die Finanziers und Haushofmeister des 21. Jahrhunderts längst keine Fürsten mehr sind.

F.K.: Im Falle von »Ariadne auf Naxos« habt ihr euch entschieden, direkt in den Text einzugreifen, wieso?
A.S.: Durch den Charakter des Komponisten zeigen Hofmannsthal und Strauss die Begegnung einer künstlerischen Idee mit der Wirklichkeit: den Schaffensprozess selbst. Der Komponist versucht verzweifelt an seinem ursprünglichen Werk festzuhalten, findet sich aber plötzlich im Abhängigkeitsverhältnis zu einem Mäzenen wieder. Um den Konflikt zwischen künstlerischem Idealismus und Alltagsrealität zu verdeutlichen, haben wir in unserer Dialogfassung die Rolle des Haushofmeisters gesplittet. Das Aufeinanderprallen dieser beiden gegensätzlichen
Welten wird durch die neu eingefügten Charaktere eines Intendanten und einer Politikerin personifiziert. Der Anfangsmonolog des Intendanten, basierend auf theatertheoretischen Texten von Dürrenmatt, Streeruwitz, Platon, Aristoteles und Schiller stellt die existentielle Suche nach aktuellen künstlerischen und gesellschaftlichen Antworten dar. Es ist ein Mit-sich-selbst-ringen, inspiriert von Lecture-Performance.

Vor dem Hintergrund des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Künstler und Kunstmarkt scheint die werkimmanente Gegenüberstellung von »hoher« und »niederer« Kunstgattungen ebenso logisch wie zeitlos, autothematisch folgt eine Reflexion über die Kunst selbst. Das gesamte Stück ist gewissermaßen ein Streit zwischen sogenannter E-Musik (»Ernster Musik«) und U-Musik (»Unterhaltungsmusik«) und offenbart damit eine weitere Dimension vom (Selbst-)Verständnis des Künstlers zwischen Kunst und Kommerz.

FK.: Ihr habt euch für ein dichotomisches Bühnenbild, was der Gegensätzlichkeit des Stückes entspricht, entschieden.
M.P.: »Unsere Insel« deutet eine verlassene Bühne mit abgerissenem Vorhang, ein Theater ohne Publikum an. Daran angeschlossen ist ein »Theater-Müll-Raum« – eigentlich ein Erinnerungsort für alte Theaterreliquien: ein Kostümfundus und Requisitenlager – mit einem großen Müllcontainer in der Mitte, in dem die Schätze der Vergangenheit, die scheinbar nicht (mehr) relevant sind, entsorgt werden können…
Auf der anderen Seite steht im Gegensatz dazu ein Sitcom-Set mit
grellen Farben, eine Art »Plastikwelt«, die die Fernsehästhetik einer populären Serie parodiert, wo die mythologischen »Götter« von heute, also Superhelden, verehrt werden. Die Oper versucht zwar sichtbar zu bleiben – auch wortwörtlich, im Portalausschnitt – die Massenunterhaltung drängt sie aber immer mehr aus dem Raum.

Strauss und Hofmannsthal stellen mit »Ariadne auf Naxos« die zwingende Frage nach dem Wirken der Kunst. Die Oper in der Oper, die hier zwischen menschlicher Schablonenhaftigkeit im Stile der Commedia dell‘Arte und wahrhaftiger Existenzkrise im Archaischen der Oper wandelt, wird zum Sinnbild für die Legitimation der Kunst. Damals wie heute zwischen Sitcom, Netflix, Streaming und Co.

F.K.: Begreift ihr die Kunst- und Theaterwelt als Flucht vor der Realität?
A.S.: Theater ist unsere Realität. Für das Publikum kann aber Theater durchaus als Flucht vor der Realität begriffen werden. Oder eben als Ort, der neue Realitäten erschafft. Bacchus, der in unserer Interpretation das Publikum selbst verkörpert, erweckt Ariadne, die Oper, durch seine Liebe zu neuem Leben. Ihre Begegnung symbolisiert für uns die Wechselwirkung zwischen Darstellenden und Publikum. In der künstlerischen Ekstase erlebt Bacchus die Metamorphose und findet zu seinem neuen, verwandelten Selbst.
Frederike Krüger,
Dramaturgin für Musiktheater und Konzert
Die Vorstellungstermine sowie eine digitale Podcast-Einführung finden Sie hier.